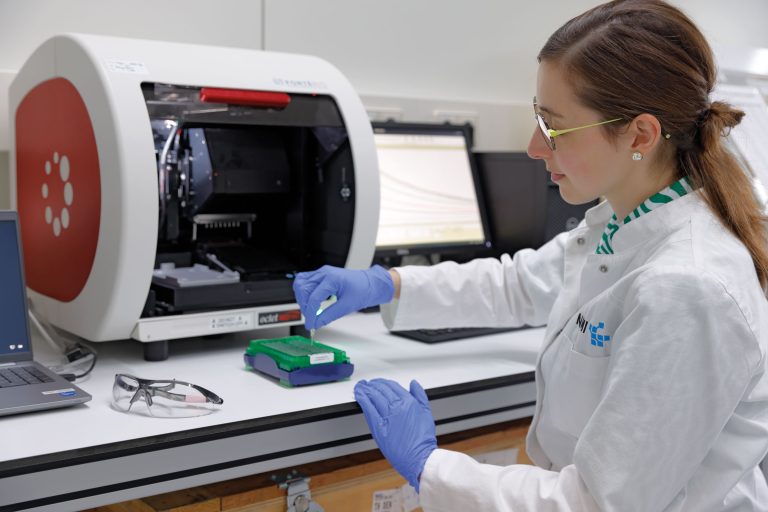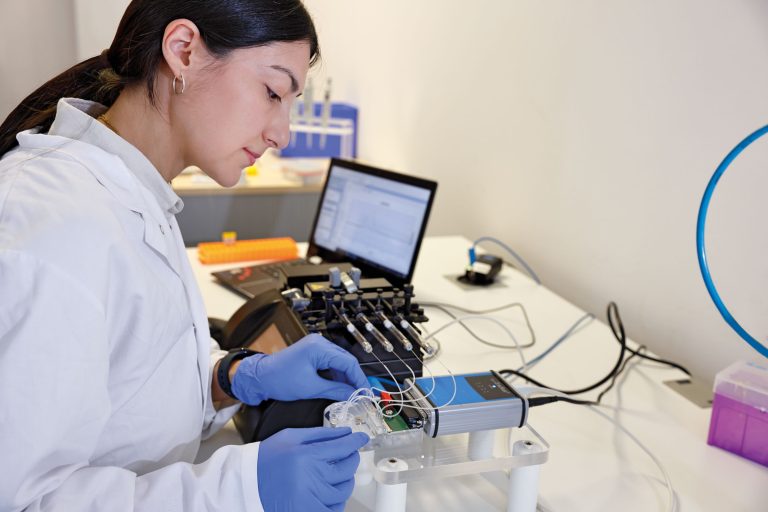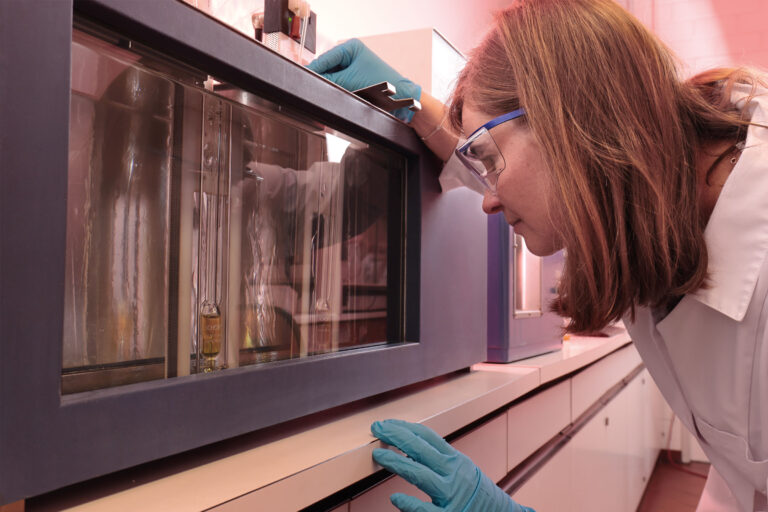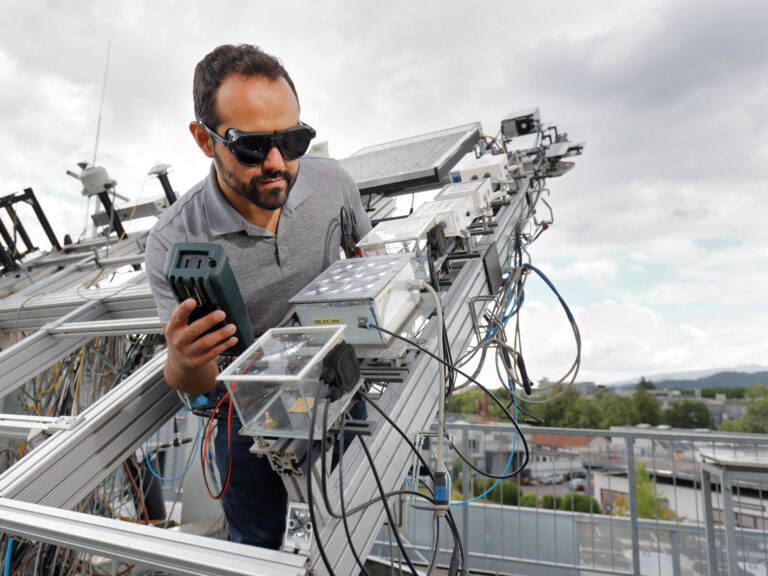Plastik ist extrem vielfältig, verursacht aber auch enorme Probleme. Die wollte Manuel Häußler lösen und hat ein Verfahren entwickelt, um die stabilen Kunststoffketten zu spalten. Das Pulver, das dabei entsteht, kann wieder zu Kunststoff werden.
Es ist billig, praktisch – aus ökologischer Sicht aber eine Katastrophe: Plastik. Manuel Häußler beschäftigt schon lange, dass der exzessive Einsatz von Kunststoff „ein riesiges Problem ist, auf das wir bisher keine Antwort haben“, wie er sagt. Deshalb hatte der junge Chemiker ein ehrgeiziges Ziel: Er wollte ein Material entwickeln, das die positiven Merkmale von Plastik besitzt – aber nicht dessen Nachteile.
In seiner Dissertation ist der 32-Jährige dem einen großen Schritt nähergekommen, denn er hat eine Alternative zu Polyethylen gefunden, dem am häufigsten eingesetzten Kunststoff. Während Wasser oder UV-Strahlung den langen stabilen Ketten von Polyethylen kaum etwas anhaben können, unterbricht Manuel Häußler die chemische Struktur mit Sollbruchstellen – mithilfe eines chemischen Verfahrens lässt sich die lange Kunststoffkette wieder gezielt spalten. „Am Ende dieses Prozesses haben wir ein schönes, weißes, kristallines Pulver, aus dem man durch eine einfache Reaktion wieder Kunststoff herstellen kann“, sagt er. Sogar stark gefärbte Kunststoffe können beim chemischen Recycling zu neuem, farblosem Kunststoff verarbeitet werden.

PREISKAMPF:
2 Euro
kostet ein Kilo Erdöl-Kunststoff im Durchschnitt. Da kann die moderne Alternative noch nicht mithalten, also muss ein günstigeres Verfahren her.
Eine Lösung, die Geschichte schreiben könnte – die allerdings ein Manko hatte: „Die Chemikalien, die ich für diese Technologie verwendet habe, waren viel zu teuer“, erzählt Manuel Häußler. Deshalb entwickelt er die Grundlagen seiner Doktorarbeit inzwischen in Forschungsgruppen in Konstanz und am Max-Planck-Institut Potsdam weiter und unterfüttert sie mit der nötigen Grundlagenforschung. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten fünf Jahren ein greifbares Endprodukt sehen, das man recyceln kann“, sagt Manuel Häußler. „Das ist eine eher optimistische Schätzung, aber im Rahmen des Möglichen.“

Mit chemischen Verfahren die Plastikflut eindämmen
Am Chemiekasten lag es nicht. Denn nachdem der kleine Manuel bei einem seiner Experimente den Wohnzimmertisch ruiniert hatte, verschwand das Kinderlabor auch schon wieder aus dem Hause Häußler. Seine eigentliche Begeisterung für Chemie wurde in der Schule geweckt. „Ich hatte eine sehr gute Lehrerin“, erzählt der 32-Jährige. Deshalb wusste Manuel Häußler schon in der achten Klasse, wie es für ihn nach dem Abitur weitergehen soll: mit einem Chemie-Studium.
Geboren wurde Manuel Häußler in Herrenberg, wo er mit mehreren Generationen aufwuchs, also auch mit den Großeltern. Da die nicht mehr die Jüngsten waren, wollte er in der Nähe bleiben und entschied sich für die Universität in Konstanz. 2010 begann er sein Studium – und als er es mit der Doktorarbeit abschließen wollte, erwischte auch ihn der Lockdown mit voller Wucht. Letztlich kam er zum richtigen Zeitpunkt, denn die Laborarbeiten waren bereits abgeschlossen. „Glücklicherweise hatte ich meine Daten beisammen“, erzählt er, „und hatte jetzt viel Zeit, von Grund auf zu überlegen, wie ich die Arbeit schreiben möchte.“
Inzwischen lebt Manuel Häußler in Potsdam, wo er am Max-Planck-Institut die Forschungsgruppe „Circular Chemical Concepts“ leitet. Da er zudem in Konstanz noch Teil einer Transfergruppe ist, bleibt für Privates wenig Zeit. Das soll sich auch wieder ändern, sagt Manuel Häußler, aber derzeit treibt ihn die Hoffnung an, „etwas bewirken zu können und mit einem Handgriff im Labor eine Hebelwirkung in der echten Welt auszulösen“.